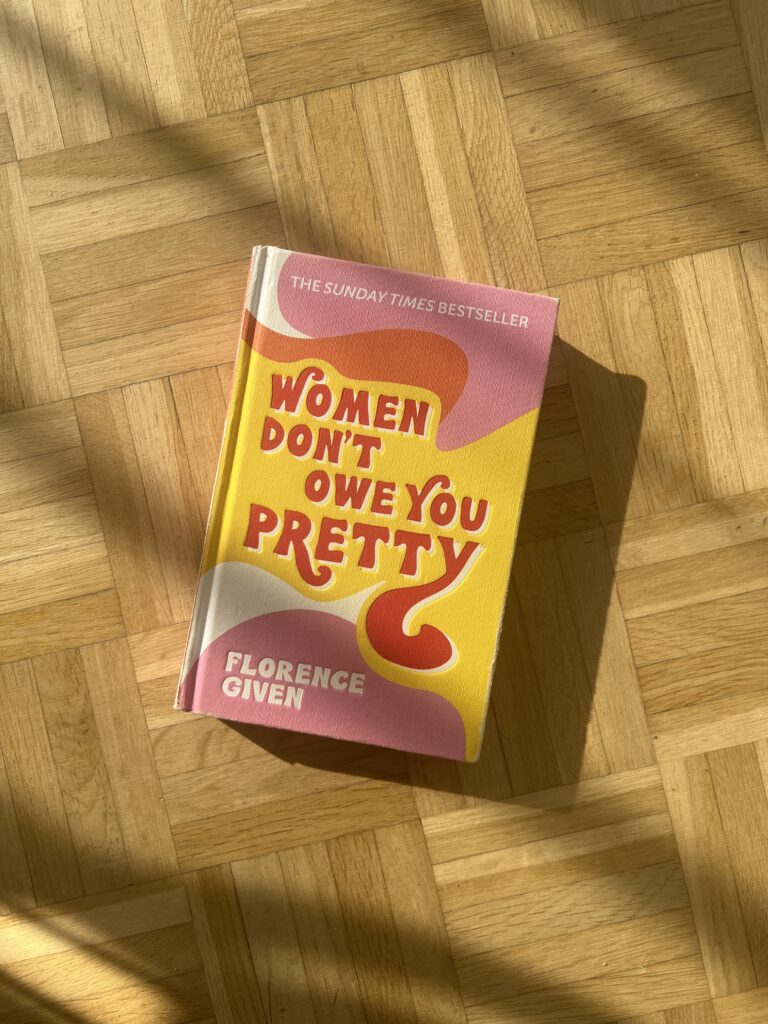Die zunehmende Verflechtung von Musikvideos mit sozialen Medien hat die Art und Weise, wie Musik visuell präsentiert und rezipiert wird, grundlegend verändert. In seinem Kapitel Music Video Meets Social Media: Intertextuality, New Aesthetics, and the Development of New Practices untersucht Eduardo Viñuela diese Transformation und analysiert die intertextuellen Beziehungen zwischen Musikvideos und nutzergenerierten Inhalten auf Plattformen wie YouTube, TikTok und Instagram (Viñuela 2024, 41).
Die Evolution des Musikvideos in der digitalen Medienlandschaft
Während Musikvideos traditionell als audiovisuelle Erweiterung eines Songs fungierten, sind sie heute Teil eines dynamischen digitalen Ökosystems, in dem Nutzer:innen aktiv an der Reproduktion und Modifikation der Inhalte beteiligt sind. Durch die wachsende Bedeutung von Social Media entwickeln sich neue Formen der Intertextualität, die nicht nur den Produktionsprozess beeinflussen, sondern auch die Ästhetik und Distribution von Musikvideos (Viñuela 2024, 44). Diese Entwicklung führt dazu, dass sich die Grenzen zwischen offiziellen und nutzergenerierten Inhalten zunehmend verwischen. Künstler:innen greifen verstärkt auf virale Trends zurück oder binden Memes in ihre offiziellen Musikvideos ein. Zum Beispiel beschreibt das Konzept von Henry Jenkins‘ „Convergence Culture“ (2006), wie verschiedene Medienformate miteinander verschmelzen und eine neue Form der Partizipation ermöglichen (Jenkins 2006, 95).
Intertextualität und die Ästhetik sozialer Medien
Ein zentrales Merkmal der neuen Musikvideoästhetik ist die Anpassung an das visuelle und narrative Format sozialer Medien. Vertikale Videos, die früher als fehlerhaft galten, stellen mittlerweile ein Standardformat für mobile Plattformen dar (Elleström 2020, 4). Viele Künstler:innen veröffentlichen offizielle vertikale Versionen ihrer Musikvideos, um sie für Instagram Stories oder TikTok optimiert zu präsentieren. Eine weitere wichtige ästhetische Entwicklung ist die zunehmende Nutzung von „Split-Screen“. Diese ursprünglich von TikTok populär gemachte Funktion erlaubt es Nutzer:innen, eigene Performances neben bereits bestehenden Videos zu platzieren, wodurch eine neue Form der interaktiven Intertextualität entsteht (Lacasse 2018, 44). Auch prominente Künstler:innen wie Mariah Carey oder Metallica haben sich dieser Technik bedient, indem sie auf TikTok mit Fans oder fiktionalen Charakteren aus populären Serien interagierten (Viñuela 2024, 50). Zudem haben sich durch soziale Medien neue Praktiken der Audiomanipulation etabliert. Besonders beliebt sind „sped-up“ Versionen von Songs, die durch künstliches Beschleunigen oder Verlangsamen eine neue klangliche und visuelle Ästhetik erzeugen. Musiklabels haben diesen Trend erkannt und veröffentlichen mittlerweile offizielle „sped-up“ oder „slowed + reverb“ Versionen von Songs, die sich an der Ästhetik populärer TikTok-Clips orientieren (Jost 2020, 34).
Strategien der Musikvermarktung und Fankultur
Musikvideos werden zunehmend als transmediale Erzählformen konzipiert, die nicht isoliert betrachtet werden können. Stattdessen sind sie Teil umfassender digitaler Marketingkampagnen, in denen Fans aktiv in den Entstehungsprozess einbezogen werden. Social-Media-Plattformen ermöglichen es Künstler:innen, vor der offiziellen Veröffentlichung eines Musikvideos Teaser-Clips, Challenges oder exklusive Behind-the-Scenes-Aufnahmen zu teilen, um die Community zu mobilisieren (Jenkins 2007).
Ein besonders prominentes Beispiel für diese Art der strategischen Fan-Einbindung sind virale Tanz-Challenges. Jennifer Lopez und Olivia Rodrigo haben gezielt kurze Videoausschnitte ihrer Songs verbreitet und Fans dazu animiert, eigene Tanzinterpretationen zu erstellen (Viñuela 2024, 55). Diese Art der Partizipation stärkt nicht nur die Bindung zwischen Künstler:in und Publikum, sondern trägt auch zur massiven Verbreitung des Musikvideos bei.
Die Zukunft des Musikvideos in der Ära der sozialen Medien
Die Analyse von Viñuela (2024) zeigt, dass Musikvideos heute nicht mehr nur als Werbeformat für einen Song fungieren, sondern als eigenständige Kunstform, die tief in die digitale Kultur eingebettet ist. Die Grenzen zwischen offiziellen Produktionen und nutzergenerierten Inhalten verschwimmen immer weiter, und Musikvideos sind zunehmend Teil eines interaktiven Netzwerks aus Remixes, Referenzen und transmedialen Strategien. Die zunehmende Digitalisierung und die Integration sozialer Medien in die Musikproduktion werden auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Musikvideos profitieren nicht nur von neuen Technologien, sondern auch durch den kreativen Input der Online-Community der stetig weiterentwickelt wird (Korsgaard 2017, 110).
Literatur
Elleström, Lars. Transmediation: Some Theoretical Considerations. New York: Routledge, 2020.
Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006.
Jenkins, Henry. „Transmedia Storytelling 101.“ Pop Junctions, 22. März 2007. https://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html.
Jost, Christofer. Integrated Pop: Intertextuality, Music Video, and Transmedia Production Modes in Popular Music. London: Bloomsbury, 2020.
Korsgaard, Mathias Bonde. Music Video after MTV: Audiovisual Studies, New Media, and Popular Music. London: Routledge, 2017.
Lacasse, Serge. „Toward a Model of Transphonography.“ In The Pop Palimpsest: Intertextuality in Recorded Popular Music, herausgegeben von Lori Burns und Serge Lacasse, 9–60. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2018.
Viñuela, Eduardo. „Music Video Meets Social Media: Intertextuality, New Aesthetics, and the Development of New Practices.“ In Aesthetic Amalgams and Political Pursuits: Intertextuality in Music Videos, herausgegeben von Tomasz Dobrogoszcz, Agata Handley und Tomasz Fisiak, 41–60. New York: Bloomsbury Academic, 2024.